Gekommen, um zu bleiben
Die Coronakrise hat das Potenzial, noch das Leben unserer Enkel in Mitleidenschaft zu ziehen. Der Grund dafür ist nicht nur das Virus, sondern auch die Art, wie wir Reichtum verteilen. Wie lang haben wir noch, um das Schlimmste zu verhindern?
Thomas Walach
Wien, 26. November 2021 | Die großen Krisen der Vormoderne folgten meist einem wiederkehrenden Muster: Ein äußeres Ereignis – klimatische Schwankungen oder eine Pandemie – sorgten für Katastrophen. Ein oder zwei Generationen später fanden die Nachfahren der Überlebenden dann oft günstige Bedingungen vor, ihr Leben zu gestalten. Die Konkurrenz um Höfe und Betriebe war geringer, Arbeitskräfte rar und die Löhne entsprechend hoch. Das änderte sich, wenn die guten Zeiten anhielten. Die Bevölkerung wuchs, der Wert der Arbeit fiel, die Nahrung wurde knapp.
Im 19. Jahrhundert wollte man aus diesen Schwankungen fälschlich ein Naturgesetz ableiten. Die Menschheit würde durch wiederkehrende Hungerkrisen in ihrem Wachstum begrenzt. Die Moderne widerlegte diese These. Heute leben acht Milliarden Menschen auf der Erde und der Planet könnte sie alle ernähren. Die großen Wirtschaftskrisen der Moderne wurden nicht durch äußere Ereignisse ausgelöst, sondern sind regelmäßig wiederkehrende Störungen im System kapitalistischer Wirtschaftsweise. Sie sind hausgemacht.
Eine Krise wie damals
Corona ist anders. Seit Anfang 2020 sehen wir uns einer Krise ausgesetzt, die erschreckend viele Züge der alten Krisen aus einer längst vergangenen Welt trägt. Und wie diese hat sie das Potenzial, über Generationen zu wirken. Es ist denkbar, dass noch unsere Enkel die Auswirkungen dieser Krise spüren werden, wenn wir sie nicht bald in den Griff bekommen.
Schauen wir uns an, wo wir im sogenannten Westen gerade stehen: Auf die unerhörten Zerstörungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts folgte eine nie dagewesene Phase des Aufschwungs. Sie dauerte ungefähr eine Generation an, bevor sie sich wieder abschwächte. Dass es zum Aufschwung kam, ist kein Wunder. Der Krieg hatte alles zerstört – es konnte nur noch aufwärts gehen. Jener Mechanismus, den wir aus den Krisen der Vormoderne kennen, setzte ein. Arbeit war teuer, Kapital großteils vernichtet. 1950 machte das weltweite Kapital „nur“ rund 270 Prozent der weltweiten Einkommen aus – ein historischer Tiefststand.
Das verlieh den Lohnabhängigen viel politisches und wirtschaftliches Gewicht. Sie konnten ihre Forderungen gegenüber den Eigentümern der Produktionsmittel durchsetzen – die Löhne stiegen gemeinsam mit der Produktivität und den Kapitaleinkommen. Doch ab den 1980er-Jahren wurde der Aufschwung langsamer und fand schließlich ein Ende; jedenfalls für die Lohnabhängigen. Denn Produktivität und Kapital wuchsen weiter an.
Reiche Oligarchen, arme Staaten
Das Verhältnis von Kapital zu Einkommen hat heute wieder den Wert erreicht, den es in der Industriellen Revolution um 1870 hatte: rund 450 Prozent. Es gibt also vier bis fünf Mal mehr Kapital, als alle Einkommen weltweit zusammengerechnet ausmachen. Selbst nach konservativen Schätzungen werden Einkommen und Kapital im Lauf des Jahrhunderts weiter auseinanderdriften – auf 600 oder 700 Prozent. Jene, die den Mehrwert der Arbeit abschöpfen, profitieren also ungleich mehr von der steigenden Produktivität als jene, die die Arbeit leisten.
Und wie sieht es mit den Staaten aus? Da alle Staaten im Westen Einkommen höher besteuern als Kapital, verschärfen sie die Entwicklung noch. Wer viel hat, dem wird mehr gelassen. Das führt auch dazu, dass die reichen Staaten selbst im Verhältnis zu den Reichsten ihrer Bürger arm sind und im Verhältnis immer ärmer werden. Das private Kapital in Westeuropa ist heute rund vier bis fünf Mal größer als das staatliche Kapital.
Um ihre Ausgaben zu finanzieren, erhöhen die Staaten nicht etwa die Steuern auf privates Kapital, sondern machen Schulden (die sie mit Steuern auf Einkommen zurückzahlen). Das geht solange gut, wie die Wirtschaft insgesamt wächst – und kann in Niedrigzinsphasen sogar ein gutes Geschäft sein.
Normale Schwankungen und Störungen wie die Finanzkrise 2007 können im Einzelfall katastrophale Auswirkungen haben, aber sie bedrohen das Gesamtsystem nicht. Doch dann kam Corona.
Der lange Weg nach unten
Erstmals seit drei Generationen verursacht ein äußeres Ereignis eine globale Krise. Die unterkapitalisierten, überschuldeten Staaten sind nicht in der Lage, die wirtschaftlichen Auswirkungen über viele Jahre abzufedern, sprich: Wir können uns nur eine begrenzte Zahl an Lockdowns leisten, ehe uns das Geld ausgeht.
Wenn das passiert, werden wir und unsere Nachkommen erleben, was Menschen seit Jahrtausenden in Krisenzeiten erlebten: Einen andauernden Abschwung bei Lebensstandard, Lebenserwartung und gesellschaftlichem Zusammenhalt. Die sogenannte „Kleine Eiszeit“ der Frühen Neuzeit war wesentlich verantwortlich dafür, dass in Europa jahrhundertelang öfter Krieg als Frieden herrschte.
Wollen wir ein Szenario langfristigen Abschwungs mit seinen unabwägbaren Folgen vermeiden, müssen wir schnell handeln. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder wir lernen, das Virus unter Kontrolle zu bringen. Oder wir schöpfen das private Kapital ab, dessen ungebremste Akkumulierung wir in den letzten 70 Jahren zuließen. Im Idealfall tun wir beides und gestalten danach unsere Lebensweise krisensicherer – in ökonomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht.
Wie viel Zeit wir dafür noch haben, ist schwer zu sagen. Aber viel dürfte es nicht sein.
Titelbild: Pixabay, ZackZack

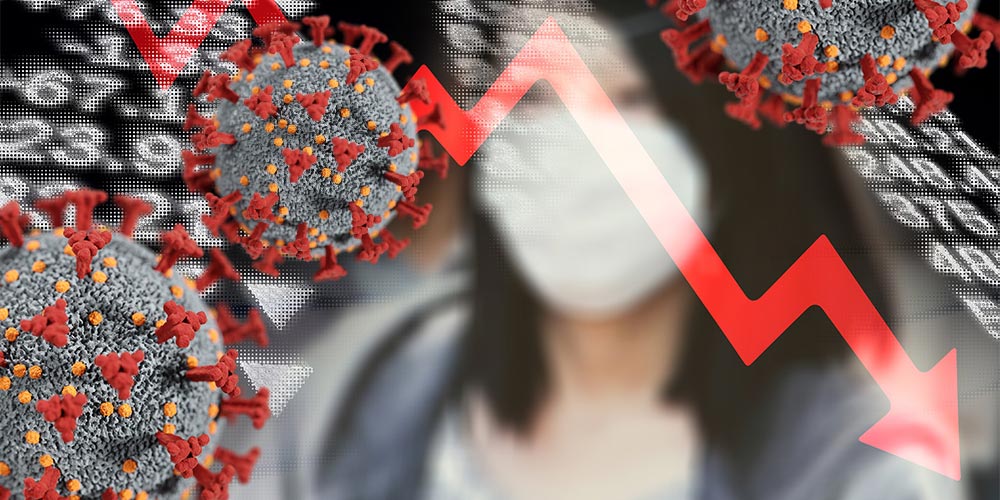

Kommentarfunktion ist geschlossen.